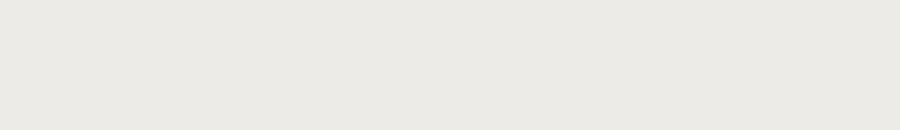Was steckt hinter der Krise in der Ukraine? Warum scheint das Wort „Putin-Versteher“ plötzlich so anrüchig zu sein? Ist es denn nicht von Vorteil, jemanden zu verstehen, sich in seine Lage hineindenken zu können? Denn das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man der gleichen Meinung sein muss. Sollten wir nicht versuchen, möglichst alle Seiten zu verstehen?
Die Europäische Union hat der geplanten Hilfe für die Ukraine einen wohlklingenden Namen verpasst: Mit einem „Marshall-Plan“ will Brüssel dem seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlich-sozialen Krise feststeckenden Land zu Hilfe kommen und das langjährige Tauziehen mit Russland so doch noch für sich entscheiden. Allerdings muss die Ukraine – so führende EU-Politiker – dafür notwendige Reformen auf den Weg bringen. Bei Finanzhilfen für die vom Staatsbankrott bedrohte Ukraine sollte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine zentrale Rolle übernehmen – dabei gilt (wie auch für andere Krisenstaaten) der Grundsatz: keine Hilfe ohne Gegenleistung. Das bestätigte auch Finanzminister Wolfgang Schäuble: „Voraussetzung für Hilfen ist, dass die notwendigen Reformen auf den Weg gebracht werden. Dafür steht der IWF.“ Darüber bestehe Einvernehmen in der Bundesregierung sowie mit wichtigen internationalen Partnern.
Der EU-Währungskommissar kann sich vorstellen, das bisherige Hilfsangebot an Kiew von 600 Mio. Euro um bis zu einer Milliarde aufzustocken, um einen drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Einigkeit über den desaströsen Zustand der Ökonomie der Ukraine ist in allen politischen Richtungen festzustellen. „Die Ukraine ist dabei, in den Abgrund zu rutschen, sie befindet sich am Rande der Zahlungsunfähigkeit“, erklärte der ukrainische Finanzminister Juri Kolobow und rief den Westen auf, eine Geberkonferenz einzuberufen. Laut Kolobow brauche die Ukraine Unterstützung in Höhe von etwa 35 Mrd. US-Dollar (ca. 25,5 Mrd. Euro). Dies sei der Bedarf für das laufende und das kommende Jahr.
Die beiden drängendsten Probleme der ukrainischen Wirtschaft sind derzeit das Leistungsbilanzdefizit und das Haushaltsloch. Durch die Auseinandersetzungen der letzten Monate ist die Wirtschaft ohne Zweifel weiter geschwächt worden, aber die Strukturprobleme der Ökonomie existieren schon seit Längerem – sie bilden den Hintergrund für die politischen und mittlerweile militärischen Konflikte. Die Ukraine steckt schon seit Jahren in einem ökonomisch-politischen Abwärtsstrudel – nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, die auch in der Ukraine zu einem massiven Absinken des Wirtschaftsprodukts geführt hat, wuchs die Wirtschaftsleistung in den beiden folgenden Jahren zwar wieder um 4 bis 5 Prozent, aber seit 2012 herrscht praktisch Stagnation. Der Schlüssel zum Aufstieg, gerade in einem Schwellenland mit großem Nachholbedarf, sind Investitionen. Die Ukraine schöpft ihre Möglichkeiten hier aber bei Weitem nicht aus, sei es als Agrarproduzent oder als Standort der Schwerindustrie, die in der Sowjetzeit hier entwickelt wurde. Zudem steckt großes Potenzial in den hiesigen Köpfen – ukrainische IT-Spezialisten gehören mittlerweile zu den besten der Welt. Und sie wandern gerne aus.
Rückblick: Die Ukraine erreichte um die Jahrtausendwende 2000 ein starkes Wirtschaftswachstum – abgesehen von der günstigen Lage auf den Weltmärkten profitierten Industrie und Landwirtschaft von der Reformpolitik der Regierung unter Premierminister Juschtschenko. Die Regierung hatte damals den Teufelskreis aus politisch unlauterer Argumentation für die Masse der Bevölkerung und damit einhergehender Rentenabschöpfung für einige wenige zurückdrängen können. Bereits im Dezember 1999 hatte der IWF die Anstrengungen der Regierung bei der Umsetzung des Reformplans gelobt und das im September 1999 eingefrorene Kreditprogramm wieder aufgenommen. Die Aufwärtsbewegung war nun unübersehbar: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2000 erstmals seit 1991 gewachsen, und zwar um 6 Prozent im Vergleich zu 1999. Experten führten den BIP-Zuwachs nicht zuletzt auf die überfällige Abwertung der nationalen Währung (Hrywnja) zurück, was die Exportwirtschaft begünstigte. Dieser Anstieg war in erster Linie von der Industrieproduktion getragen, die gegenüber dem Vorjahr um satte 12,9 Prozent zulegte. Die größte Dynamik entwickelten (mit Zuwachsraten zwischen 26 und 39 Prozent) die Lebensmittelindustrie, die Holzverarbeitung, die Papierproduktion sowie die Leichtindustrie, gefolgt von exportorientierten Sektoren wie Stahl und metallurgische Produkte. Dort wurden Zuwächse von bis zu 21 Prozent registriert.
Auf Grund ihrer so gestärkten Position im Ausland gelang es der Ukraine ebenfalls, die Auslandsschulden deutlich zu senken. Diese fielen 2013 von mehr als 12 Mrd. US-Dollar auf weniger als 10 Mrd. US-Dollar. Parallel dazu erreichte die Regierung eine Umschuldung mit den privaten Gläubigern im London-Klub. Die eigentliche Herausforderung für die Ukraine bestand allerdings darin, die Trendwende in der Wirtschaft nachhaltig zu machen. Laut einer OECD-Studie aus dem Jahr 2007 behinderten die ukrainischen Regierungen den dafür notwendigen Strukturwandel aber, anstatt ihn zu fördern. Der Anteil der verschiedenen staatlichen Renten am BIP betrugt damals ca. 14 Prozent und ist damit einer der höchsten weltweit – und die Steuerlast steigt seit 2003 stetig an, was in einem krassen Gegensatz zu der Politik zahlreicher ostmitteleuropäischer Staaten steht, die mit neoliberalen Steuerreduktionen und unbürokratischen Vereinfachungen ihrer jeweiligen Volkswirtschaft in den letzten Jahren neuen Schwung verleihen konnten.
Natürlich wurde 2008 auch die Ukraine durch die Rückwirkungen der großen internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise schwer geschädigt. Im Gefolge des drastischen Einbruchs der Exporte und des Abflusses internationalen Kapitals wurde die nationale Währung einer massiven Abwertung (um über 50 Prozent seit Sommer 2008) unterworfen. Das hat zwar den Exporteuren etwas Luft verschafft, brachte aber die vielfältigen Unternehmen der ukrainischen Armee in Schwierigkeiten, die hohe Kredite in Fremdwährung aufgenommen hatten. Eine Welle von Bankrotten war die Folge, von der sich das Land nicht mehr erholte. Als weiteres Problem führte der Rückgang der Wirtschaftsleistung zu schrumpfenden Staatseinnahmen. Die Herausforderung, der Bevölkerung im Bemühen um einen ausgeglichenen Staatshaushalt eine Rosskur verordnen zu müssen, wurde zum zentralen Punkt des Wahlkampfes, in dem die damalige Ministerpräsidentin Timoschenko und ihr Umfeld untergingen.
Der 2010 demokratisch ins Amt gewählte Präsident Wiktor Janukowytsch wollte nun die Ökonomie mit einem Investitionsprogramm nach vorne bringen – aber die Finanzressourcen fehlten. In den Jahren seines politischen Regimes hat zudem die Abzweigung von gesellschaftlichen Mitteln zur persönlichen Bereicherung einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Finanzexperten der Opposition in der Ukraine sprechen von ca. 30 Milliarden US-Dollar, die dem Land entzogen und überwiegend in ausländische Steueroasen geschafft wurden. Die Schweiz hat erst kürzlich einen Kontenstopp für den Janukowytsch-Clan verhängt, der hier bereits über ein Vermögen in Höhe von rund 500 Millionen Schweizer Franken verfügen soll. Intensivierte Korruption und jahrelang verschleppte Strukturreformen prägten den Alltag der Janukowytsch-Regierung und damit auch die gesellschaftliche Entwicklungsdynamik. Als der Karren dann richtig tief im Dreck steckte, konnte Janukowytsch im November 2013 noch drohende „Anpassungsschwierigkeiten ukrainischer Unternehmen“ ins Feld führen, sollte das Land ein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit der EU eingehen. Er verweigerte deshalb seine Unterschrift und versuchte danach, von Moskau ein akzeptables Hilfspaket zu erhalten. Neben einer sofortigen Finanzhilfe von 15 Mrd. US-Dollar ging es dabei um billigeres Erdgas und gegenseitigen Handelsaustausch ohne Auflagen. Das konnte ja dem Westen nicht gefallen…
Vertragliche Grundlage der Beziehungen der Ukraine zur EU ist das im März 1998 in Kraft getretene Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA). Das ursprünglich nur bis Februar 2008 geltende PKA soll aber bis zur Ablösung durch ein Assoziierungsabkommen in Kraft bleiben. Kern des Assoziierungsabkommens, das die Ukraine durch Übertragung der EU-Gesetzgebung wirtschaftlich und politisch schrittweise näher an die EU heranführen soll, ist ein umfassendes Freihandelsabkommen. Die Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen, die im Februar 2007 begannen, konnten beim EU-Ukraine-Gipfel am 19. Dezember 2011 abgeschlossen werden – das Abkommen wurde am 30. März 2012 paraphiert. Die Unterzeichnung wurde dann allerdings ausgesetzt – Grund war einerseits die Besorgnis der EU über die Lage von „Demokratie, Menschenrechten und Korruption“, andererseits stellte das Abkommen mit der EU auch harte Bedingungen an die Ukraine. Allein das Freihandelsabkommen wäre eine drastische Belastung für den Großteil der Unternehmen in der Ukraine geworden – die EU verlangte aber zudem auch noch die völlige Unterwerfung unter das Regime des IWF. Praktisch hieß die Umsetzung dieser Forderungen: Erhöhung der Energiepreise für alle ukrainischen Privathaushalte um 50 Prozent, Einfrieren der Altersrenten auf dem jetzigen niedrigen Niveau und gleichzeitig keinerlei Verbesserungen bei Stipendien und Sozialleistungen. Mit einem Wort: EU und IWF haben der Ukraine einen Cocktail der bekannten Austeritäts-Maßnahmen angeboten. Dieser war zudem noch gewürzt mit politischen Forderungen, die letztlich auf eine Entmachtung des zwar korrupten, aber demokratisch gewählten Präsidenten Janukowytsch hinausliefen. Warum sollte Janukowytsch so etwas unterschreiben?
Seit Beginn der Regierung Janukowytsch ging es um die recht grundsätzliche Frage, ob sich die Ukraine eher nach Russland oder dem Westen ausrichten soll. Die EU verknüpfte die Assoziation mit einem harten Übergang in die Wettbewerbspolitik. Ebenso evident war aber auch, dass die Ukraine aufgrund ihrer historischen und wirtschaftlichen Verbindungen nach Osten nicht einfach so tun kann, als gäbe es Russland nicht, auch wenn man vielleicht eine Westintegration trotz Austeritäts-Maßnahmen bevorzugen würde. Spätestens seit Sommer 2013 ist die desolate Lage der ukrainischen Ökonomie und der öffentlichen Finanzen nicht mehr zu übersehen. Der Konflikt hat inzwischen die Ebene einer harten Konfrontation zwischen Russland und dem Westen erreicht – es werden erhebliche Anstrengungen notwendig sein, um den aus dem „Integrationswettbewerb“ entstandenen Schaden zu begrenzen.
Für die Ukraine selbst trifft die Schlussfolgerung von Ursula Koch-Laugwitz aus den „Blättern für Deutsche und Internationale Politik“ sicherlich zu, wenn sie schreibt: „Eine Fortsetzung der Politik der Integrationskonkurrenz, ein reines Tauziehen zwischen Ost und West um die Ukraine, wird am Ende keinen Gewinner hervorbringen. Denn letztlich kommt es in erster Linie darauf an, dass die ukrainischen Akteure einen Ausweg aus der schweren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise finden. Es wird allzu häufig übersehen, dass die meisten Menschen demonstrieren, weil sie Angst um ihre Zukunft haben – ganz gleich, ob sie die EU-Integration oder die Eurasische Union befürworten. Jede neue Regierung wird sich daher daran messen lassen müssen, ob sie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in der Ukraine verbessern kann.“ Doch noch bleibt die Lage in der Ukraine kritisch – die Ergebnisse der „Referenden“ in ost-ukrainischen Gebieten waren eindeutig, blieben aber bislang ohne Konsequenzen. Inzwischen scheint sogar ein Runder Tisch im Bereich des Möglichen – begleitet von wechselseitigen Schuldzuweisungen und Zumutungen: Denn natürlich sind die Terroristen immer die Anderen.
Während im Februar 2014 westliche Regierungen der Janukowytsch-Regierung angesichts drohender „Anti-Terror-Operationen“ mit Sanktionen drohten und Druck ausübten, ist davon im April oder Mai 2014 nicht mehr die Rede. Im Februar war unter Vermittlung der Außenminister des Weimarer Dreiecks eine Vereinbarung getroffen worden, die eine Übergangsregierung der nationalen Einheit ebenso vorsah wie eine Aufklärung der Gewaltakte auf dem Maidan – beides ist jedoch bisher nicht geschehen. Eine Mehrheit der Parlamentsabgeordneten etablierte eine Regierung unter Einschluss ukrainisch-völkischer Nationalisten. Vertreter der Swoboda-Partei und des Rechten Sektors stellten Minister und den Generalstaatsanwalt. Der Einfluss dieser nationalistischen Kräfte zeigte sich bereits in den ersten Stunden, als das Parlament durchaus die Zeit fand, ein Sprachengesetz aufzuheben, um den Gebrauch der russischen Sprache zurückzudrängen. Zentrales Element jedes Nationalismus in Europa ist nun mal die Sprachpolitik…
Außerdem müssen nun natürlich noch Denkmäler für Nationalhelden errichtet werden, man braucht eine eigene Nationalhymne, eigene Briefmarken, eine Flagge sowie national(istisch)e Legenden. In diesem Zusammenhang bietet sich die Stilisierung der Maidan-Toten zu Märtyrern und Freiheitskämpfern an, da diese angeblich von feindlichen Janukowytsch-Scharfschützen ermordet wurden. Da ist dann eine Zusammenarbeit mit dem Europarat bei der Aufklärung der Scharfschützeneinsätze auf dem Maidan vermutlich eher störend, denn schon jetzt steht fest, dass hier auch noch andere Scharfschützen als die von Janukowytsch im Einsatz waren und vom Dach des Hauses der Opposition aus in die Menge feuerten.
Dass die Umsetzung des Sprachgesetzbeschlusses letztendlich doch nicht erfolgte, ändert nichts daran, dass der politische Schritt angesichts der zentralen Dimension von Sprache im nationalistischen Kontext in manchen Landesteilen als Kampfansage verstanden wurde – zumal einige Wochen später auch russische Sender in der Ukraine vielfach nicht mehr empfangen werden konnten: Der Nationale Fernseh- und Rundfunkrat hatte die Provider aufgefordert, die Sendungen der Fernsehanstalten Rossija 1, Rossija 24, ORT, RTR Planeta und NTV-MIR vorübergehend einzustellen. Nach dem Stand vom 25. März 2014 haben 443 der insgesamt 703 ukrainischen Provider die russischen Fernsehkanäle bereits abgeschaltet – dass die Ausstrahlung der ukrainischen Sender auf der Krim ebenfalls „vorübergehend eingestellt“ wurde, sei der Vollständigkeit halber hier auch erwähnt.
Was die ukrainisch-völkischen Kräfte in der Kiewer Regierung betrifft, sahen die westlichen Unterstützer keinen Grund einzuschreiten oder zumindest die wirtschaftliche Hilfe an die Bedingung zu knüpfen, dass diese Kräfte die Regierung zu verlassen haben. Die ursprüngliche Idee einer Übergangsregierung, die alle Teile, also auch die russischsprachigen bzw. russisch-völkischen Kräfte, repräsentieren sollte, wurde fallengelassen. Dagegen rebellierten natürlich die ausgeschlossenen Kräfte – mit freundlicher Unterstützung aus Russland inklusive russischer Freischärler aus verschiedenen Ländern und Regionen. Während sich manche Politiker der ukrainischen De-facto-Regierungbereits im Krieg mit Russland sehen und der eingesetzte Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk sogar erklärte, dass Russland den Dritten Weltkrieg anzetteln wolle, sind stichhaltige Beweise für eine regierungsamtliche Unterstützung der Aufständischen in der Ostukraine bisher sehr dünn. So behauptet der frühere Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Andreas Schockenhoff (CDU), es gäbe „Nachweise, dass Operationen im Osten und Süden der Ukraine unmittelbar von russischen Politikern gesteuert werden“. Dabei stützt er sich auf ein angeblich von der ukrainischen Botschaft weitergeleitetes abgehörtes Telefonat zwischen dem führenden russischen Nationalisten Alexander Barkaschow und einem Separatisten-Anführer in Donezk. Dass Barkaschow 2005, also mitten in der Putin-Ära, wegen einer Attacke auf einen russischen Polizisten verhaftet wurde, erwähnte Schockenhoff nicht. Insofern kann Barkaschow wohl kaum als Repräsent- ant der russischen Führung gelten – doch diese Tatsache hätte nicht so gut zu seiner Propaganda-Story gepasst…
Auch die neue Jazenjuk-Regierung setzt von Anfang an auf „Anti-Terror-Einsätze“ und bedient sich dabei (im Gegensatz zu Janukowytsch noch vor ein paar Monaten) auch des Militärs für Einsätze im eigenen Land. Dabei gibt es tagtäglich Tote in verschiedenen Regionen – inzwischen haben in der Ost- und Südukraine schon mehr Menschen ihr Leben gelassen als während der gesamten Auseinandersetzung zwischen Janukowytsch-Regierung und Maidan-Demonstranten. Die US-Regierung hat mit diesen „Anti-Terror-Einsätzen“ selbstredend kein Problem – schließlich kennt man sich in Washington ja gut mit dem „Krieg gegen den Terror“ aus. „Die ukrainische Regierung hat die Verantwortung, Recht und Ordnung herzustellen“, erklärte Regierungssprecher Jay Carney und fügte hinzu: „Die Provokationen pro-russischer Kräfte schaffen eine Situation, in der die Regierung handeln muss.“
Die deutsche Regierung sieht die Lage immerhin etwas anders. Sie stellte infrage, ob die Versuche Kiews, Rathäuser und abgeriegelte Stadtgebiete im Osten zurückzuerobern, zum gegenwärtigen Zeitpunkt einer Lösung des Konflikts dienlich sind. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, warnte die Übergangsregierung in Kiew davor, mit ihrem gewaltsamen Vorgehen gegen die Separatisten im Osten die Chance auf eine diplomatische Vermittlung in der Krise zu verspielen. Aber anstatt Jazenjuk und weitere De-facto-Regierungsmitglieder auf Sanktionslisten zu setzen, werden diese nicht nur vom Westen beraten, sondern auch aktiv unterstützt. Der vom Westen favorisierte Präsidentschaftskandidat, der Schokoladen-Oligarch und Sponsor der Maidan-Infrastruktur Petro Poroschenko, erschien Anfang Mai 2014 zu einem Antrittsbesuch bei der Bundesregierung und erklärte bei der Gelegenheit, dass die bewaffneten Separatisten „Terroristen“ und davon „manche geisteskrank“ seien.
Wie so oft in Bürgerkriegen werden auch hier von beiden Seiten Verbrechen begangen – natürlich hat man es bei den bewaffneten Separatisten genauso wenig wie beim Rechten Sektor oder der Swoboda- Partei mit „lupenreinen Demokraten“ zu tun. Über Entführungen, Folterungen und Morde der pro-russischen Separatisten wird in den westlichen Medien stets ausgiebig berichtet, während sich die Empathie für die Opfer der anderen Seite in engen Grenzen hält. Die verbrecherische Brandstiftung vom 2. Mai in Odessa, durch die nach offiziellen Angaben 46 (pro-russische) Ukrainer starben, wird so zu einer „Tragödie“ verharmlost. Man vergleiche damit die Empathie, die den Opfern auf dem Maidan entgegengebracht wurde…
Die „Anti-Terror-Operationen“ der neuen ukrainischen Regierung sind offenbar mit dem Westen abgestimmt – dafür sprechen die Besuche von US-Vizepräsident Biden (21. April 2014) und CIA-Direktor Brennan (12. und 13. April 2014) in Kiew. Am 4. Mai 2014 berichtete dann sogar die BILD-Zeitung über CIA- und FBI-Mitarbeiter in der Ukraine: „Die Beamten sollen im Auftrag der US-Regierung Kiew dabei helfen, die Rebellion im Osten des Landes zu beenden und eine funktionsfähige Sicherheitsstruktur aufzubauen.“ Aber auch Söldner seien im Osten der Ukraine aktiv – dabei handele es sich um Personal der Firma Greystone, einer Tochterfirma von Academi (die früher Blackwater bzw. Xe Services hieß). Natürlich weiß hier keiner genau, wer die Rechnungen letztendlich begleicht und ob die bisher unbekannten Scharfschützen am Maidan auch diesem „Personal“ zugeordnet werden können.
Bei den Bürgerkriegseinsätzen gegen die Separatisten kommt inzwischen auch die im März 2014 neu formierte Nationalgarde zum Einsatz. Diese rekrutierte sich zuallererst aus den „Selbstverteidigungs- kräften“ des Maidan. „An vorderster Front kämpfen dort auch nationalistische Paramilitärs des Rechten Sektors – ausgerüstet mit Nazi-Symbolen“, berichtete schon am 9. März 2014 die Tagesschau (ARD), und die Frankfurter Rundschau resümierte ein paar Tage später: „Es waren die Anführer des Rechten Sektors, Dmitri Jarosch, und des Kampfverbandes Samoobrona (Selbstverteidigung), Andri Parubi, die in den Kiewer Schicksalstagen Ende Februar den Sturz von Präsident Janukowytsch durchsetzten.“ Eben jener Jarosch klärte schließlich auf, dass Kampfgruppen des Rechten Sektors inzwischen zu Nationalgardisten mutierten: „Diese unsere Bataillone sind Teil der neuen Territorial-Verteidigung.“ Für das Blutbad in Mariupol am 9. Mai mit 20 Toten ist eine Einheit dieser neuen ukrainischen Nationalgarde verantwortlich, die aus Dnepropetrowsk in Marsch gesetzt wurde. Diese schoss offenbar auch auf örtliche Polizisten, die selbst nicht gegen die Separatisten vorgehen wollten.
In Dnepropetrowsk regiert seit dem Regimewechsel in Kiew der Gouverneur Kolomojskij, den die FAZ als „Oligarchen des Westens“ bezeichnet. Er wird als „der bei Weitem wichtigste private Sponsor“ bezeichnet, der die „nationale Verteidigung“ von Dnepropetrowsk unterstütze. Dafür unterhält er gewissermaßen eine Privatarmee – zur Motivation seiner Truppe will er „Kopfgeld aus seinem Privatvermögen für die Ergreifung eines pro-russischen Bewaffneten“ bezahlen. Die tarifliche Staffelung erläuterte der Tagesspiegel in Berufung auf Kolomojskijs Stellvertreter Filatow: „Wer einen bewaffneten Soldaten der pro-russischen Kräfte verhaftet, erhält demnach 10.000 US-Dollar. Für Gewehre und Granaten werde pro Stück 1.500 bis 2.000 Dollar gezahlt. Für die Räumung von besetzten Gebäuden werde bis zu 200.000 Dollar gezahlt.“
Aufklärungsunterstützung versuchten offenbar auch Deutschland und EU-/NATO-Länder zu leisten, als sie Militärbeobachter in die Ost-Ukraine entsandten, die dort dann von den lokalen Separatisten gefangen genommen wurden. Die mediale Sprachregelung, es seien OSZE-Beobachter, stellte sich schnell als falsch heraus – in Wirklichkeit basierte der Einsatz auf einer Einladung der ukrainischen De-facto-Regierung an einige westliche Regierungen unter Berufung auf das Wiener OSZE-Dokument über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Der Einsatzleiter Oberst Schneider hatte die Ziele der Mission in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk ganz offen benannt: Es gehe darum, sich „rasch und schnell ein Bild von der Verfassung der ukrainischen Streitkräfte machen zu können“, von der „Schlagkraft der Einheiten“, und „in welchem Zustand die sind und was sie leisten können“. Paul Schreyer erläutert das auf www.heise.de so: „Die Regierung der Ukraine bittet ausländische Militärs, die eigenen Truppen zu einem Einsatz in einen umkämpften Landesteil zu begleiten. Dies ist sicher keine Situation, wie sie den Autoren des „Wiener Dokuments“ bei dessen Formulierung vorschwebte. Eher erinnert sie – in spiegelbildlicher Umkehrung – an das, was Putin gemeinhin unterstellt wird: die Entsendung von Beratern zur direkten Unterstützung einer Konfliktpartei.“
Immerhin hat sich die deutsche Bundesregierung vor ein paar Wochen den Vorschlag zu eigen gemacht, zur Deeskalation einen „Runden Tisch“ einzurichten. Dieses kommunikative Möbelstück war bereits (ohne Ergebnisse) im Dezember 2013 genutzt worden, als dort Janukowytsch als gewählter Präsident zusammen mit Vitali Klitschko und Jazenjuk Platz nahm. Nun wollte Außenminister Franz-Walter Steinmeier Runde Tische mit den Konfliktparteien unter Moderation der OSZE einrichten – doch da griff Putin am 6. Mai den Vorschlag „von Kanzlerin Merkel“ auf und erklärte sich zu Verhandlungen bereit. Sogleich erklärten Vertreter der Kiewer De-facto-Regierung, dass man nicht mit den bewaffneten Separatisten bzw. Terroristen zu verhandeln gedenke. Übergangspräsident Alexander Turtschinow und Regierungschef Arseni Jazenjuk riefen stattdessen zu einem „nationalen Dialog“ auf – eher ein Konzept für ein nationales Selbstgespräch. Sanfter Druck der westlichen Sponsoren dürfte dann dazu geführt haben, dass der gleiche Jazenjuk schon einen Tag später einen gesamtnationalen Runden Tisch für den 14. Mai 2014 ankündigte. In diesem Zusammenhang machte Steinmeier dann folgende Entdeckung: In der Ostukraine gibt es „eine Reihe von separatistischen Gruppen, die weder auf Moskau noch auf Kiew hören“. Tatsächlich hatte Putin erfolglos an die Separatisten appelliert, die für den 11. Mai angesetzten Referenden abzusagen. Damit stellt sich der deutsche Außenminister gegen den westlichen Mainstream und gegen wichtige Amtskollegen. Diese verwenden nämlich das eher einfach gestrickte Weltbild, wonach alles Ungemach in der Ukraine direkt vom Kreml gesteuert wird. So befand US-Außenamtssprecherin Jennifer Psaki: „Präsident Putin und die Russen könnten viel mehr tun, um eine Deeskalation in der Ukraine zu erwirken und sichere Präsidentenwahlen zu gewährleisten. Wir rufen Russland auf, seinen Einfluss auf bewaffnete Gruppen zu nutzen, um die Lage zu stabilisieren, damit alle Ukrainer am 25. Mai ruhig abstimmen können.“ In einer Spiegelung dieses Weltbilds forderte der russische Außenminister Lawrow die USA auf, ihren Einfluss auf die Regierung in Kiew zu nutzen, damit sich diese für eine „wahre Deeskalation“ im Land einsetze und die Voraussetzungen für direkte Gespräche auf Augenhöhe mit Vertretern der südöstlichen Regionen schaffe. Der übliche westliche Zwischenruf lautet nun: Bei Russland handele es sich ja um ein autokratisches System, das quasi mittels Befehl und blindem Gehorsam geführt werde. Das sei im Westen natürlich ganz anders – allein deswegen sei das alles gar nicht vergleichbar. Die banale Wahrheit ist jedoch, dass die lokalen Akteure ein Eigenleben führen und nicht einfache Befehlsempfänger ihrer internationalen Unterstützer sind – das gilt eben auch für die Separatisten. Die Frage ist allerdings, wie die externen Unterstützer und Sponsoren auf „ihre“ lokalen Kräfte einwirken, welche Forderungen oder Bedingungen sie stellen und welcher politische Wille dahinter steckt. Im Genfer Abkommen war im April vereinbart worden, alle illegalen bewaffneten Gruppen zu entwaffnen, alle illegal besetzten Gebäude ihren legitimen Eigentümern zurückzugeben und alle illegal besetzten Straßen, Plätze oder anderen öffentlichen Flächen in den ukrainischen Städten und Gemeinden zu räumen. Dem kamen jedoch beide Seiten nicht nach.
Die NATO und die Ukraine hatten 1997 vereinbart, „das naturgegebene Recht aller Staaten zu achten, ihre Sicherheitsvereinbarungen (einschließlich Bündnisverträge) frei zu wählen und umzusetzen oder diese im Laufe ihrer Entwicklung zu wechseln“. Abgesehen davon, dass allein die USA seit 1991 mit 5 Milliarden US-Dollar nachhalfen, dass hier auch die „richtigen“ Entscheidungen getroffen wurden und dass das Völkerrecht entsprechende Passagen nicht kennt, muss man feststellen, dass – wenn derartige Entscheidungen autistisch-nationalistisch getroffen werden – sie nicht unbedingt friedensfördernd sind. Insbesondere Beitritte zu einem Militärpakt wie der NATO müssten natürlich mit den Nachbarstaaten ausgelotet werden. Das gilt auch für einen EU-Beitritt, zumal die EU mit dem Lissabon-Vertrag mittlerweile den Charakter eines Militärpakts angenommen hat. Dieser wird nicht nur von ukrainischen Politikern wie Julia Timoschenko gefordert, ihr sprangen auch die beiden GRÜNEN Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour und Manuel Sarrazin bei. Mit ihrer Forderung, die Ukraine in die EU aufzunehmen, gehen sie über das bisherige geopolitische Konzept der EU hinaus, das die Ukraine nur über ein Assoziationsabkommen einbinden wollte. Bereits das hatte bekanntlich genügt, um den gegenwärtigen Konflikt zu befeuern.
Am 30. Mai kündigte der ukrainische Verteidigungsminister an, den Einsatz der Armee im eigenen Land so lange weiterführen zu wollen, „bis das normale Leben wieder Einzug in der Region hält“. Doch wann das ist, kann man im Augenblick noch nicht absehen. Man kann nur die Opfer zählen – seit Mitte April 2014 (dem Beginn der Offensive des ukrainischen Militärs gegen die Separatisten) wurden in der Region bereits mehr als 250 Menschen getötet. Zudem wird in letzter Zeit auch der ukrainische Ruf nach Energieautarkie bzw. Unabhängigkeit von russischen Rohstofflieferungen immer lauter. Dabei wird eins gerne übersehen: In dem Maße, in dem sich der Westen unabhängig von den russischen Energieträgern macht, wendet sich Russland nach Asien und wird damit gegen westlichen Druck immer immuner. So geht es bei der Debatte um das russische Gas auch um eine langfristige geopolitisch-strategische Weichenstellung: Sollen Zusammenarbeit und Handel mit Russland in den nächsten Jahren auf homöo- pathisches Niveau heruntergefahren werden oder sollen die Beziehungen auf allen Ebenen intensiviert werden? Der Chefredakteur der russischen Zeitschrift für Außenpolitik Rossija w globalnoi politike, Fjodor Lukjanow, hat eine Antwort parat: „Gibt Russland seine Westausrichtung auf, wird die Weltkarte neu gezeichnet.“ Logische Begleiterscheinung der westlichen Abwendung von Russland wäre dessen stärkere Hinwendung zu China, inklusive der Realisierung entsprechender Pipelineprojekte. Am Ende stände ein geopolitisches Eigentor des Westens, denn ganz grundsätzlich sind Kooperation und Handel immer ein guter Weg zur Verhinderung von Kriegen und dem Einengen von Konflikten. Man stelle sich vor, es gäbe derzeit keinerlei wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der EU und Russland – das unmittelbare Abdriften in konfrontative militärische Reaktionsmuster wäre direkt vorgezeichnet – mit unabsehbaren Folgen für die ganze Welt. Daher gilt es (nun und für immer), die friedliche Kooperation zu verteidigen und nach wie vor ruhig mal zu versuchen, „den Putin“ (oder andere „Bösewichte“) zu „verstehen“.