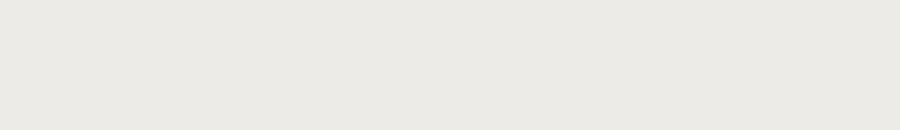Der internationale „War on Drugs“ – der verharmlosend auch gerne als Drogenpolitik bezeichnet wird – ist ein Krieg gegen Menschen. Wie immer in einem Krieg trifft es auch hier vor allem die Schwächsten in der Gesellschaft. Ganz besonders deutlich wird das in den USA, dem Land mit den meisten Gefangenen der Welt. Im „Land of the Free“ fristen mittlerweile über 2,3 Millionen Menschen ihr Leben hinter Gittern – die meisten Gefangenen stammen aus armen Verhältnissen, gehören ethnischen Minderheiten an, sind sehr jung oder sehr alt und sitzen nicht etwa wegen Gewalttaten und Schwerverbrechen ein, sondern vor allem wegen gewaltloser Drogendelikte.
Ramarley Graham wurde von der Polizei wegen einem Tütchen Gras ermordet. Der 18-jährige US-Bürger jamaikanisch-afrikanischer Abstammung aus der New Yorker Bronx wurde am 2. Februar 2012 von der Polizei in der Wohnung seiner Familie erschossen. Die Polizisten waren dem Jugendlichen gefolgt, nachdem sie ihn an einem Ort beobachtet hatten, von dem sie vermuteten, dass dort mit Cannabis gehandelt wird. Bei der Wohnung angekommen, verschafften sie sich gewaltsam und ohne Durchsuchungsbefehl Zutritt zu der Wohnung (indem sie einfach die Eingangstür eintraten) und stellten Ramarley auf der Toilette. Einer der Polizisten erschoss den Jugendlichen, weil er vermutete, dass dieser eine Waffe in seinem Hosenbund versteckt hatte und es für ihn wohl danach aussah, als würde Ramarley danach greifen. Später stellte sich heraus, dass der Junge unbewaffnet war und die Polizisten gaben zu Protokoll, sie hätten ein Tütchen mit Cannabis in der Toilette gefunden – Ramarley hatte offensichtlich versucht es noch schnell herunterzuspülen. Obwohl Videoaufnahmen zeigen, dass Ramarley ganz normal nach Hause ging, behaupteten die Polizisten, er sei vor ihnen davongelaufen und habe sich in der Wohnung verschanzt. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befanden sich auch die Grossmutter und der kleine Bruder des Opfers mit in der Wohnung. Die anklagende Frage der 58-jährigen Frau, warum er ihren Enkel erschossen habe, soll der Polizist mit “Verpiss dich, bevor ich dich auch noch erschiesse!” erwidert haben, bevor er sie brutal beiseite schob.
Der Polizist, der den Schuss abgegeben hatte, wurde zwar wegen Totschlags angezeigt, plädierte dann aber auf „nicht schuldig“ und wurde nie verurteilt.
Leider ist das nur einer der jüngsten, zahlloser Fälle, bei denen junge Afroamerikaner von Polizisten oder Mitgliedern sogenannter Bürgerwehren getötet werden und straffrei ausgehen. Spätestens seit Michael Brown in Ferguson und Kajime Powell im benachbarten St. Louis in kurzen Abständen im Sommer 2014 von weißen Polizisten erschossen wurden – beide Opfer waren wie Ramarely Graham unbewaffnet – und den Protesten und teilweise gewalttätigen Ausschreitungen, die daraufhin im ganzen Land ausbrachen, ist in den USA wieder einmal eine Debatte über den latenten Rassismus amerikanischer Polizeibehörden und in der Gesellschaft im Allgemeinen entstanden. Hier ein paar Fakten dazu:
Seit den 80er Jahren und dem offiziellen Beginn des “War on Drugs” hat sich die Zahl der Gefangenen in den USA von damals 500.000 auf heute 2,3 Millionen mehr als vervierfacht.
Von den Inhaftierten sind über die Hälfte afroamerikanischer Abstammung.
Beim derzeitigen Trend wird einer von drei Afroamerikanern früher oder später eine Gefängnisstrafe verbüßen – zur Jahrtausendwende war es einer von sechs.
Besonders im „War on Drugs“ sprechen die Zahlen für ein System der Ungerechtigkeit. Aktuelle Statistiken des Amts für Gesundheit und Drogenmissbrauch (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) in den USA zeigen, dass weiße und afroamerikanische Bürger ähnlich viel illegale Drogen nehmen – trotzdem werden Afroamerikaner viel öfter dafür verhaftet und deutlich härter bestraft. Das hat dazu geführt, dass (auch wenn Afroamerikaner lediglich 13% der US-Bevölkerung ausmachen) fast zwei Drittel der Häftlinge, die wegen Drogendelikten im Strafvollzug sitzen, afroamerikanischer Herkunft sind. Der “Feind” im Krieg gegen die Drogen ist nicht etwa das organisierte Verbrechen, sondern das letzte und schwächste Glied in der Kette: die Konsumenten. Bei vier von fünf Drogendelikten, die in den USA zur Anzeige gebracht werden, handelt es sich um Drogenbesitz und nicht Handel.
Im Kern rassistisch
Der “War on Drugs” wurde offiziell zwar erst 1971 vom damaligen Präsidenten Richard Nixon erklärt, historisch betrachtet begann dieser Krieg jedoch schon sehr viel früher – und er war von Beginn an rassistisch geprägt.
1875 beschloss der Verwaltungsrat von San Francisco, den vor allem unter hiesigen Chinesen sehr verbreiteten Konsum von Opium zu verbieten. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes wurde zum ersten Mal deutlich, wie eng der Rassismus der herrschenden weißen Klasse und die sogenannte Drogenpolitik miteinander verbunden sind und dazu missbraucht werden, Minderheiten zu diskriminieren und zu kriminalisieren. So wurde schon damals eine effektive gesellschaftliche „Kontrolle“ der Minderheiten betrieben – denn obwohl damals auch viele Weiße den Schlafmohn in den sogenannten “Opiumhöhlen” rauchten, waren es vor allem die chinesischen Einwanderer, die durch das Verbot betroffen und plötzlich kriminalisiert wurden.
Zur Zeit des Eisenbahnbaus noch als billige Arbeitskräfte geschätzt, sahen sich die Einwanderer aus Fernost bald mit Diskriminierung und Fremdenhass konfrontiert, als sie sich friedlich neben der weißen Bevölkerung im “Land der unbegrenzten Möglichkeiten” niederlassen wollten. Die genügsamen Chinesen wurden plötzlich als Lohndrücker und potentielle Gefahr für die amerikanische Gesellschaft wahrgenommen und angeprangert. Das Gesetz gegen das Rauchen von Opium (damals Teil der chinesischen Kultur und ein Mittel, welches half, harte Arbeit und allgemein schlechte Lebensbedingungen zu ertragen) diente dazu, rassistische Vorurteile und die Angst vor der “gelben Gefahr” innerhalb der Gesellschaft zu schüren und die nun eher unerwünschten Chinesen ihrer Freiheit zu berauben. Das Gesetz war hoch selektiv und stellte lediglich das Rauchen von Opium unter Strafe – also die Konsumform der Chinesen. Der orale Konsum der Weißen blieb dagegen straflos.
Von da an wurde das Konzept, ganze Bevölkerungsschichten über den Konsum verbotener Substanzen zu kriminalisieren und zu kontrollieren, immer wieder angewandt.
Anfang des 20. Jahrhunderts traf es dann vor allem die schwarze Bevölkerung, als man den Konsum von Kokain (ebenfalls ein weiterverbreitetes und alltägliches Arzneimittel, das es damals in der Apotheke gab) dämonisierte.
1925 fand die auf Prohibition basierende Drogenpolitik auf der zweiten internationalen Drogenkonferenz einen neuen, traurigen Höhepunkt mit dessen Konsequenzen wir zum Teil heute noch leben. Auf dieser Konferenz wurden die ersten weltweiten Kontrollmaßnahmen eingeführt, welche die Grundlage für das 1961 beschlossene und bis heute gültige Einheitsabkommen für Betäubungsmittel (Single Convention on Narcotic Drugs) bildete. Hier wurde auch die vielseitige Nutzpflanze Hanf – neben Kokain und Heroin – in die Liste gefährlicher Substanzen aufgenommen.
Es waren damals vor allem die Vertreter Südafrikas, Ägyptens und der Türkei, die dafür plädierten, Cannabis in das Anti-Drogen-Abkommen aufzunehmen. Damit gelang es dem weißen Apartheid-Regime Südafrikas, die schwarze Bevölkerungsmehrheit (bei der der Konsum von Cannabis weit verbreitet war) zu kriminalisieren. Dabei gab es (auch) damals (schon) keinerlei Hinweise auf soziale oder gesundheitliche Probleme in Zusammenhang mit dem Gebrauch von Cannabis – und dennoch wurde dem Antrag (ökonomischen und politischen Interessen folgend) zugestimmt.
Mit der Gründung des Federal Bureau of Narcotics unter Führung von Harry J. Anslinger, nahm die rassistische Kampagne gegen Kokain, Cannabis und deren vermeintliche Konsumenten – die Afroamerikaner und Mexikaner – in den 30er Jahren ganz neue und erschreckende Formen an. Zitate wie “Gras lässt die Farbigen glauben, sie seien ebenso gute Menschen wie die Weißen” und “Die Schwarzen missbrauchen weiße Mädchen, die unter dem Einfluss von Marihuana stehen – das Ergebnis sind Schwangerschaften und Syphilis…”, sind nur zwei seiner ebenso demagogischen wie rassistischen Äußerungen.
Es ist vor allem Anslinger und seinem guten Freund – dem Medienmogul und politisch sehr weit rechts stehenden William Randolph Hearst – zu „verdanken“, dass aus der alten Nutzpflanze Hanf (während des zweiten Weltkriegs noch als “Hemp for Victory” gefeiert und angepflanzt) die „Teufelsdroge“ der Farbigen und Mexikaner wurde. Die angeblich neue Droge nannte man “Marihuana” (mexikanisches Slang-Wort für Rauchhanf) – ein Wort, dass keine Ähnlichkeiten mit Hanf vermuten ließ. Durch eine bis dahin beispiellose Hetzkampagne wurden Afroamerikaner und andere Minderheiten von Behörden und der von Hearst kontrollierten Boulevardpresse gezielt als gewalttätige Schwerverbrecher stigmatisiert, die unter dem Einfluss der “mexikanischen Mörderdroge” die amerikanische Zivilisation in ihren Grundfesten bedroht.
Die gezielte Kriminalisierung und Kontrolle ethnischer und sozialer Minderheiten unter Anwendung verschiedener Drogenverbote zieht sich seit dieser Zeit – also seit gut 100 Jahren – wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte.
Die Ghettoisierung der Städte
In ihrem Buch The new Jim Crow beschreibt die Soziologin und Aktivistin Michelle Alexander, wie es zwischen 1910 und 1970 sechs Millionen Afroamerikaner aus den ehemaligen Südstaaten und der Mitte Amerikas in die Großstädte zog. Viele waren ehemalige Sklaven und deren Nachkommen und sie suchten nach besseren Lebensumständen für sich und ihre Familien. “The American Dream” – wonach alle Menschen gleich sind und jeder eine Chance auf ein besseres Leben und das Streben nach Glück hat – erschien vielen dieser lebenslang ausgebeuteten und völlig mittellosen Menschen in greifbarer Nähe und so flüchteten sie aus den Regionen der USA, in denen noch immer das rassistische System der Rassentrennung (“Jim Crow-Gesetze“) durchgesetzt wurde.
Leider sahen sich die meisten Afroamerikaner auch in den urbanen Zentren der Vereinigten Staaten – statt mit Gleichheit und Brüderlichkeit – mit neuen Formen des Rassismus konfrontiert. Auf die von Martin Luther King und Malcolm X angeführte Bürgerbewegung und die von ihr abgeschaffte gesetzliche Rassentrennung folgte nicht wie erwartet die Gleichberechtigung in einer multikulturellen Gesellschaft, sondern eine neue Form des institutionellen Rassismus: Das System der Massenkriminalisierung.
Eine verfehlte Stadtplanung und der Verlust von Arbeitsplätzen in den Innenstädten in den 50er und 60er Jahren führte zur Bildung riesiger Armenviertel – den Ghettos der Großstädte – deren Bewohner der (mit großer Armut und Perspektivlosigkeit verbundenen) auswuchernden Kriminalität schutzlos ausgeliefert waren. Der Begriff “No Go Areas” stammt aus dieser Zeit, in der ganze Stadtteile von der Gesellschaft aufgegeben und sich selbst überlassen wurden – hier wagte sich auch die Polizei nicht hinein bzw. sie hatte gar kein Interesse daran, helfend einzugreifen. Damit war der perfekte Nährboden für Drogenmissbrauch und den damit verbundenen illegalen Handel geschaffen und die Entwicklung zum Schauplatz des „War on Drugs“ nahm ihren Lauf.
Wann immer Polizisten eine Verhaftung vornehmen müssen um die vorgegebene Quote zu erfüllen, zieht es sie an die selben Plätze, in dieselben Viertel in denen vor allem ethnische Minderheiten leben, wo dieselben Menschen mit dem Verdacht auf Drogenhandel durchsucht, verhaftet und verurteilt werden. In einem System, in dem es vor allem auf die Anzahl der Ermittlungen und Verhaftungen ankommt, fällt es natürlich leichter, Menschen wegen Drogenbesitz zu belangen, als Gewaltverbrechen oder andere Straftaten aufzuklären und echte Verbrecher dingfest zu machen. Das hat zum sogenannten (und eigentlich bei der Polizeiermittlung untersagten) “Racial Profiling” geführt, bei dem Tatverdächtige allein wegen ihres Aussehens (dunkle Haut, männlich, jung) und ihres Aufenthalts in bestimmten Gegenden ins Visier der Polizei geraten.
Dieses Vorgehen hat über die Jahrzehnte zu klaren Fronten und zu Vorurteilen auf beiden Seiten geführt. Für die Polizisten sind die Bewohner einschlägiger Viertel alle ausnahmslos in den Drogenhandel verwickelt. Unbeteiligte und damit Unschuldige gibt es für sie nicht. Die Bewohner sehen in der Polizei hingegen eine feindliche Besatzungsmacht, die die soziale Gemeinschaft mit allen Mitteln zerstören will – und auch die Mittel dafür hat.
Wo es an Arbeitsplätzen und Perspektiven mangelt, bleibt den Menschen oft nichts anderes übrig, als andere Mittel und Wege zu finden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist dann auch verständlich, dass sie sich irgendetwas suchen, was ihnen (wie einst den Chinesen in San Francisco) dabei hilft, ihre schlechten Lebensumstände zu vergessen – so entsteht ein Teufelskreis aus Angebot und Nachfrage, bekanntlich eines der obersten Prinzipien des Kapitalismus.
Wie es der investigative Journalist und Autor der mehrfach preisgekrönten Serie The Wire (die u.a. im Drogenmilieu von Baltimore zu Anfang der Jahrtausendwende spielt) Dan Simon ausdrückt: “Wenn die einzige Firma in der Stadt, die Arbeiter einstellt, mit Drogen handelt – dann wird man halt zum Drogendealer. Das ist eine völlig rationale Entscheidung auf ökonomischer Basis.”
Krieg ohne Sinn und Ende
Am 17. Juni 1971 erklärte US-Präsident Richard Nixon während einer Pressekonferenz des Weißen Hauses den Drogenmissbrauch zum Staatsfeind Nummer 1 und versprach, den Krieg gegen die Drogen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und aller nötigen Härte zu führen. Wie man einen Krieg gegen eine Substanz führt (die ja keine Armee hat, sondern eher einer Idee oder einem Lebensgefühl entspricht) erläuterte er nicht im Detail. Aber Nixon konnte so die Angst vor Kriminalität und Drogenabhängigkeit bei der amerikanischen Bevölkerung schüren und seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöhen. Während die Bilder von schwarzen Demonstranten und gewalttätigen Ausschreitungen durch die Nachrichten gingen, setzte er sich mit starker Hand für „Recht und Ordnung” ein. Offiziell trat Nixon zwar für die Gleichberechtigung aller Volksgruppen ein, doch er stellte sich in der Praxis gegen alle dies fördernden Maßnahmen und seine Rhetorik zielte meist auf die hellhäutige Bevölkerung ab, die vor einem schwarzen Mob auf den Straßen und auch davor Angst hatte, dass Afroamerikaner plötzlich bessere Jobs bekamen als man selbst. Subtil setzte er Afroamerikaner mit Kriminellen gleich und schürte so bereits latent vorhandene Ängste. Besonders die sozial Schwachen fürchteten sich damals davor, von den ehemaligen Sklaven überholt zu werden. Die martialische Ansprache Nixons kam daher gut bei den weißen Wählern (die sich mit dem “Wir, die Weißen gegen die Anderen” identifizierten) an und bescherte ihm mit herausragender Mehrheit die angestrebte Wiederwahl. Nun hatte Amerika einen neuen abstrakten Feind: Die Drogen. Und damit alle, die damit irgendwie zu tun hatten. Bald darauf verabschiedeten viele amerikanische Staaten drakonische Drogengesetze, die Drogendelikte mit obligatorischen Höchststrafen ahndeten.
Erstaunlich ist dabei, dass das Programm Nixons anfänglich auf Prävention und Rehabilitation statt auf Verfolgung und Prohibition aufgebaut war. Nixon war durchaus bewusst, dass Drogensucht eine Frage der öffentlichen Gesundheit ist und nicht mit Strafverfolgung und harten Gesetzen gelöst werden konnte. Macht- und innenpolitisch war das aber unheimlich praktisch – also musste es Krieg geben.
Doch erst unter der 8-jährigen Präsidentschaft von Ronald Reagan explodierte der „War on Drugs“ Anfang der 80er Jahre und Nixons Wahlversprechen, diesen Krieg mit allen Mitteln zu führen, wurde von seinem Nachfolger noch rücksichtsloser umgesetzt. Reagan vermied es zwar offen rassistisch zu sein, aber in seinen Reden hetzte er stets gegen soziale Schmarotzer und geisselte jene, die angeblich die Sozialsysteme ausbeuteten und so auf Kosten der hart arbeitenden Mittelschicht lebten. Er nutzte geschickt die Angst der Menschen, indem er die Gefahr der Straßenkriminalität völlig übertrieben darstellte. Reagan vermied explizite Äusserungen mit Bezug auf die Hautfarbe – der rassistische Grundton war aber unmissverständlich vorhanden.
Nachdem Reagan die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, forcierte er den „War on Drugs“, indem er die Budgets für FBI, CIA, DEA und Verteidigungsministerium um ein Vielfaches erhöhte und Präventions- und Rehabilitationsprogramme gnadenlos strich. Der Drogenbehörde DEA und dem Verteidigungsministerium standen nun zwei Milliarden Dollar zur Verfügung, während das Bildungs- und Gesundheitsministerium nur noch ein Fünftel ihres vorherigen Budgets erhielt.
Reagans aggressive Anti-Drogen-Politik in den 80er Jahren sollte die bisher schlimmsten Auswirkungen des „War on Drugs“ auf die schwarze Bevölkerung haben. Um das gnadenlose polizeiliche Vorgehen, den Einsatz polizeilicher Gewalt und die hohen Haftstrafen zu rechtfertigen, bediente sich Reagan einer neuen Droge, die Anfang der 80er Jahre in den Strassen amerikanischer Großstädte aufkam: Crack-Kokain.
Crack ist eine rauchbare Form von Kokain, es wird über die Lunge aufgenommen und wirkt so stärker als klassischer „Schnee“. Die Droge wurde in kleineren Dosen und viel billiger als gewöhnliches Kokain verkauft und entwickelte sich so schnell zur Droge der Armen.
Zweifellos richtete Crack – in einer Zeit, die sowieso schon von hoher Arbeitslosigkeit und Bandengewalt geprägt war – vor allem unter der afroamerikanischen Bevölkerung großen sozialen Schaden an. Die Reagan-Administration verschärfte das Problem noch weiter und nutzte es für ihre politischen Interessen, anstatt die soziale Ungerechtigkeit hinter dem Problem zu beheben. Reagan machte das Gegenteil und beauftragte PR-Firmen, die Angst vor einer Crack-Epidemie weiter zu schüren, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ein gnadenloser Krieg gegen die Drogen und deren Konsumenten unverzichtbar sei und weiterhin mit aller Härte geführt werden müsse. Bald beherrschte Crack die Schlagzeilen und Fernsehnachrichten – allein in der Washington Post wurden innerhalb eines Jahres über 1000 Artikel veröffentlicht, die vor der “Drogenseuche” warnten.
Dabei steht heute fest, dass es sich bei den angeblichen “Crack-Heads” (die man damals in in den Abendnachrichten präsentiert bekam und vor denen in einer Weise gewarnt wurde, dass man annehmen musste, sie würden bald wie eine Horde Zombies die Strassen amerikanischer Grossstädte beherrschen) oftmals um Alkoholkranke, Geisteskranke und Obdachlose handelte, um die sich die amerikanische Politik und die Gesellschaft schon damals einen Dreck scherte.
Drogenhändler waren die Terroristen der 80er und 90er Jahre – schaut man sich stupide Actionfilme von Schwarzenegger, Stallone & Co sowie TV-Serien aus dieser Zeit an, sind es vor allem schwarze Gangster und südamerikanische Kartellbosse, die den “American Way of Life” und unschuldige, weisse Mädchen mit ihren Drogen zerstören. Doch dann kommt der “American Hero” mit großer Knarre und jeder Menge Munition und rettet neben dem schönen Mädchen auch noch die Welt.
Bevor Reagan 1982 erneut den „War on Drugs“ erklärte (war Nixons Kriegserklärung etwa von den Drogen gar nicht angenommen worden?), glaubten gerade mal 2 Prozent der Amerikaner, dass Drogen ein großes gesellschaftliches Problem darstellen. Nach Jahren des Dauerfeuers durch die Massenmedien waren es dann 1989 schon 64 Prozent. Das Bild des typischen Drogenhändlers hat sich in den Augen der US-Bevölkerung seit dieser Zeit kaum verändert – so beschreiben 95 Prozent der Bürger einen schwarzen, jungen Mann zwischen sechzehn und fünfundzwanzig, wenn man sie danach fragt, wie sie sich einen typischen Drogenabhängigen vorstellen. Unter einem Terroristen stellen sich die Meisten dagegen einen arabisch aussehenden jungen Mann zwischen sechzehn und fünfzig, teilweise mit und teilweise ohne Bart vor. Nach dieser Logik haben sogar Terroristen noch eine höhere Lebenserwartung als Drogenkonsumenten.
Crack lieferte Reagan den perfekten Vorwand, es half dabei zu erklären, warum in den armen Stadtvierteln Gewalt und Verwahrlosung herrschten und warum mit aller staatlicher Gewalt dagegen vorgegangen werden müsse. Dass der Grund für die elendigen Zustände in den Ghettos vor allem auf eine verfehlte Sozialpolitik zurückzuführen war, wurde von den Medien weitestgehend ignoriert. Reagan gefiel sich in der Rolle des Verbrechensbekämpfers – eine Rolle, die er in seiner Zeit als Schauspieler schon öfters belegt hatte. Dem Vorwurf des Rassismus entzog er sich dabei immer – schließlich bekämpfe man das Verbrechen ja vor allem in den Vierteln der afroamerikanische Bevölkerung mit dem (angeblichen) Ziel, deren Lebensumstände zu verbessern.
Die Spitze der Ungerechtigkeit wurde erreicht, als die Reagan-Administration einen Gesetzesentwurf verabschiedete, der dafür sorgte, dass der Handel und Besitz von Crack 100 Mal höher bestraft wurde, als der von herkömmlichem (teureren/unter Weißen weit verbreiteten) Pulverkokain. Nach dem neuen Gesetz bekam man für den Besitz von 5 Gramm Crack mit einem Wert von 20 US-Dollar eine Mindeststrafe von 5 Jahren – die gleiche Strafe wie für den Besitz von einem halben Kilo (!) Kokain. Dabei besteht der einzige Unterschied zwischen Crack und gewöhnlichem Kokain darin, dass dem Crack noch Wasser und Backpulver beigemischt und das Ganze erhitzt wird, um es rauchen zu können. Ansonsten ist Crack ebenso schädlich für die Gesundheit und birgt das gleiche Abhängigkeitspotenzial wie Kokain.
Eine so viel höhere, obligatorische Bestrafung ließ sich weder moralisch noch wissenschaftlich rechtfertigen.
Inzwischen wurde das Gesetz von Barack Obama immerhin geändert und Crack wird heute “nur noch“ in einem Verhältnis von 18 zu 1 im Vergleich zu Kokain bestraft.
Der „War on Drugs“ nahm auch Einfluss auf Amerikas Außenpolitik und wurde vor allem in Südamerika geführt, wo das amerikanische Militär einheimische Truppen trainierte, mit Waffen und Logistik unterstützte und so politischen Einfluss auf die Region nahm.
Reagan war es, der aus der Strafverfolgung tatsächlich einen Krieg machte. Unter ihm begann die Militarisierung der Polizei, indem man den Polizisten militärische Ausrüstungen wie Granatwerfer und Sturmgewehre zur Verfügung stellte und sie so ausbildete, dass sie diese auch bei sozialen Unruhen gegen die Zivilbevölkerung einsetzen konnten.
Was Reagan etablierte, wurde in den Jahren danach von jedem US-Präsidenten fortgeführt. Durch die Bombardierung der Massenmedien waren Drogen und alle, die damit etwas zu tun hatten, das Böse in Person, was es mit allen Mitteln zu vernichten und mit aller Härte zu bestrafen galt. Über Jahrzehnte verfolgten die Vereinten Nationen – angeführt von den USA – das Ziel einer drogenfreien Welt. Dieses Ziel war angeblich nur mit einem totalen Krieg zu erreichen. Nach Reagan unternahm kein Präsident mehr irgendwelche nennenswerten Anstrengungen, die verheerende und falsche Drogenpolitik zu hinterfragen oder gar zu beenden.
Wer will im Wahlkampf schon als derjenige dastehen, der nicht hart und mit allen Mitteln gegen das Verbrechen vorgeht? Die beiden Bushs, Bill Clinton und auch Barack Obama jedenfalls nicht. Clinton erließ während seiner Amtszeit sogar noch restriktivere Gesetze, darunter die „Three Strikes” Regelung, nach der die Möglichkeit besteht, Straftäter bei der dritten strafrechtlichen Verurteilung (für was auch immer) als Wiederholungstäter lebenslänglich einzusperren.
Die unmenschliche Verschärfung der Gesetze sorgte dafür, dass Hunderttausende, vor allem junge Afro- und Lateinamerikaner, wegen gewaltloser Drogendelikte für Jahrzehnte oder gar lebenslänglich hinter Gittern landeten. So ist noch immer der Eindruck verbreitet, Afroamerikaner und Latinos würden deutlich mehr Crack und andere Drogen als Weiße konsumieren – dabei haben zuverlässige Studien längst gezeigt, dass 52% aller Crack-User weiß, 38% afroamerikanisch und 10% lateinamerikanisch sind. Ganz anders sieht es hingegen bei den Verurteilungen wegen Crack-Besitzes aus – hier sind 80% der Verurteilten Afroamerikaner und nur jeweils 10% Latinos und Weiße.
In vielen Staaten der USA verliert man als Vorbestrafter das Recht auf Sozialhilfe, Gesundheitsvorsorge, Weiterbildung oder sogar das Wahlrecht. Als ehemaliger “Knacki” einen Job zu finden ist fast aussichtslos, weil man bei jedem Job-Interview angeben muss, ob und weshalb man vorbestraft ist. Wer beschäftigt schon gerne ehemalige, vermeintlich gewalttätige Drogenhändler oder -süchtige? So sehen sich viele Ex-Häftlinge gezwungen, nach ihrer Entlassung doch wieder mit Drogen zu handeln – und rutschen so zurück in den Konsum. Es entsteht ein Teufelskreis aus neuen Vergehen und immer höheren Haftstrafen, aus dem es fast kein Entkommen gibt.
Da bleibt die Frage zu klären, warum der Krieg gegen die Drogen auch unter einem nicht ganz so hellhäutigen Präsidenten (dem ohne Zweifel bewusst sein wird, zu welchen verheerenden sozialen Missständen diese verfehlte Drogenpolitik vor allem bei den Minderheiten und Armen führt) fortgesetzt und kaum in Frage gestellt wird.
Klassenkampf
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde zwar ein neuer abstrakter Feind (der radikale islamische Terror) gefunden und ein neuer nicht zu gewinnender Krieg (der „War on Terror“) erklärt – doch das hatte nicht etwa zur Folge, dass der Krieg gegen die Drogen beendet (geschweige denn gewonnen) worden wäre.
In den 80er Jahren war Crack die alles zerstörende Teufelsdroge – Ende der 90er Jahre wurde dann Methamphetamin (wegen seiner durchsichtigen oder blauen Farbe auch Crystal genannt), eine rauchbare Form von Speed, von den immer sensationslüsterneren Medien zur neuen Superdroge erklärt.
Methamphetamin wird vor allem von der seit der Finanzkrise 2008 verarmten weißen Arbeiterklasse hergestellt, gehandelt und konsumiert. So erhielten nun auch unzählige sozial schwache Weiße (oft nur als “White Trash” bezeichnet) unverhältnismäßig hohe Haftstrafen wegen gewaltloser Drogendelikte und füllten im Rahmen des von George W. Bush initiierten “Combat Meth Act” (der die Strafgesetzgebung für den Besitz und die Herstellung von Amphetaminen drastisch verschärfte) die Gefängnisse.
Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: Heroin, Kokain und Methamphetamin sind alles sehr schädliche Substanzen und deren Missbrauch kann schlimme gesundheitliche und soziale Folgen für den Einzelnen, dessen Umfeld und die Gesellschaft haben. Das rechtfertigt aber nicht, dass Hunderttausend Menschen – die keine Gewaltverbrechen begangen haben – ihr Leben, teilweise bis zum Tod, hinter Gittern verbringen müssen. Ganz ohne irgendeine Perspektive oder die Chance auf Rehabilitation.
Mit dem Krieg gegen die Drogen begann in den USA auch der Trend der Privatisierung der Haftanstalten. Angelehnt an den “Military-Industrial-Complex” – vor dem der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower in den fünfziger Jahren in seiner Abschiedsrede warnte – steckt hinter dem “Prision-Industrial-Complex” die unmenschliche und geradezu faschistische Idee, dass man soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Drogenmissbrauch und Geisteskrankheiten lösen kann, in dem man die betroffenen Menschen einsperrt und dabei auch noch Unmengen an Geld mit ihnen macht.
Die Entwicklung des Kapitalismus im 21. Jahrhundert hat dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen im Laufe ihres Lebens in Notsituationen wiederfinden, aus denen sie alleine nicht herauskommen können. In einer sozialen Marktwirtschaft hilft der Staat den Hilfsbedürftigen, im neo-liberalen System – dessen Schreckensherrschaft wir zur Zeit erleben – ist jeder sich selbst überlassen. Kein Wunder also, dass auch immer mehr Weiße harte Drogen konsumieren oder damit handeln, um ihrer finanziellen und sozialen Misere zu entkommen. Dabei wird auch das urkapitalistische Prinzip von Angebot und Nachfrage erfüllt. Mehr Armut sorgt für mehr Kriminalität und somit für mehr verurteilte Straftäter, für die man wiederum mehr Haftanstalten braucht, deren Zellen gefüllt werden wollen. So entstand eine ganze Industrie, von der Millionen Arbeitsplätze abhängen und mit der Billionen Dollar gemacht werden.
In den USA werden Gefangene als billige oder sogar unbezahlte Arbeitskräfte im Strassenbau, in Call Centern und bei der Herstellung von zahlreichen Produkten beschäftigt. Wer kann unter diesen Umständen den Vergleich mit der Sklaverei von sich weisen?
Realität ist, dass heute mehr Menschen der Kontrolle des US-amerikanischen Justizsystems unterliegen, als zur Hochzeit des Sklavenhandels. So betrachtet, ist der „War on Drugs“ eben nicht gescheitert – als Klassenkampf gegen die Armen ist diese Politik zumindest ein finanzieller Erfolg für diejenigen, die an gut gefüllten Gefängnissen verdienen.
Ähnlich sieht das der amerikanische Historiker Richard Miller, für den die US-Drogenpolitik vor allem ein Ziel hat: Die systematische Zerstörung unerwünschter Bevölkerungsschichten. Von den chinesischen und mexikanischen Einwanderern des 19. und 20. Jahrhunderts, über die schwarzen Flüchtlinge der grossen Migration ab den 30er Jahren, hin zu den Scharen Arbeitsloser aller Hautfarben der Gegenwart. In diesem Sinne ist der Kapitalismus wirklich farbenblind. Wer keinen finanziellen Wert hat bzw. erfüllt, ist überflüssig und damit wertlos. Ganz egal, ob der Mensch schwarz, braun, gelb, rot oder auch weiss ist. Miller nennt es die “Kette der Zerstörung”, bei der eine Minderheit innerhalb der Gesellschaft zunächst entmenschlicht wird, gefolgt von der Ausgrenzung und der Verfolgung der zum Feind erklärten Gruppe, der Enteignung des Besitzes (in den USA werden im Rahmen von Drogendelikten jährlich Millionen in Form von Bargeld, Bankkonten, Häusern, Autos oder sonstigen Wertgegenständen vom Staat im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmt) und anschliessend dem Entzug der persönlichen Freiheit.
Wandel in Sicht?
In den letzten Jahren hat sich vor allem in den USA viel in der Drogenpolitik geändert. Washington und Colorado machten 2012 den Anfang und waren die ersten Bundesstaaten, die den Gebrauch von Cannabis für den Freizeitkonsum legalisierten. Seitdem haben auch Oregon, Alaska sowie die Städte Portland und South Portland nachgezogen. Wie erwartet hat sich dadurch inzwischen eine boomende, grüne Industrie rund um den Anbau und Verkauf von Cannabis gebildet und brachte alleine dem Vorreiter-Staat Colorado im ersten Jahr 185 Millionen Dollar an Steuereinnahmen. Auf die missliche Lage der benachteiligten Minderheiten hat der “grüne Grasrausch” aber bisher kaum erkennbare positive Auswirkungen gehabt.
Von der millionenschweren und boomenden Cannabis-Branche profitieren vor allem wieder männliche Weiße mittleren Alters. Von den über 210.000 inhaftierten Afroamerikanern, die zwischen 1986 und 2010 meist wegen des Besitzes geringer Mengen Cannabis verurteilt worden sind, sitzen die Meisten nach wie vor hinter Gittern. Tausende junger Menschen sind für den Besitz der selben Pflanze inhaftiert, an der sich nun ihre weißen Altersgenossen ganz legal eine grün-goldene Nase verdienen.
Leider ist die in den USA florierende Cannabiskultur alles andere als multikulturell. Das große Geschäft mit den legalen Buds ist mal wieder fest in weißen Händen und während die Wähler von Colorado und Washington meistens weiß sind, ist in Staaten wie Iowa – in dem acht von zehn Gefangenen Afroamerikaner sind – eine Änderung der Gesetze noch lange nicht in Sicht. Dabei bietet gerade das legale Geschäft mit Cannabis und die damit verbundenen Einnahmen in Millionenhöhe die einmalige Chance, die vom „War on Drugs“ angerichteten Schäden zumindest teilweise zu beheben.
Michelle Alexander vergleicht das mit der Situation Südafrikas nach dem Fall der Apartheid: “Am Ende der Apartheid in Südafrika entwickelte sich ein Bewusstsein innerhalb der Gesellschaft, dass es keine Heilung, keinen Fortschritt und keinen Frieden ohne Wahrheit geben kann. Man kann nicht über Jahrzehnte Leute misshandeln und töten und anschliessend sagen: ‘So jetzt ist Schluss. Wir werden das nicht mehr tun.’ Man muss mit der Geschichte offen umgehen, um sie verarbeiten zu können. Im Fall der Legalisierung von Cannabis, hat man – bevor man sich die Hände reibt und im Stil von “business as usual” Hunderte Millionen Dollar macht – die Pflicht sich zu fragen, wie man das Leid und den Schaden, den der „War on Drugs“ in den letzten vierzig Jahren vor allem in den Gemeinden der Afroamerikaner angerichtet hat, wieder gut machen kann. Wie die Südafrikaner müssen wir Amerikaner uns bewusst werden, dass hier ein systematischer Krieg gegen die Schwächsten der Gesellschaft geführt wurde und immer noch geführt wird.”
Dan Simon sieht das ganz ähnlich und warnt: “Der War on Drugs muss beendet werden. Es darf nicht damit getan sein, dass man den Konsum von Cannabis entkriminalisiert und die weiße Mittelklasse daran prächtig verdient, während man Minderheiten auch weiterhin verfolgt und bestraft.”
Die deutsche Realität
In Deutschland herrscht zwar (noch) kein so perfides und rassistisch geprägtes System wie in den USA, aber auch hier richtet sich die grundlegend falsche Drogenpolitik (das Wort “Krieg” nehmen deutsche Politiker in diesem Zusammenhang ja nicht so gern in den Mund) vor allem gegen sozial Schwache und Minderheiten.
Besonders deutlich wird das an der steigenden Anzahl von Zuflucht suchenden Menschen aus Krisengebieten. Auch in den deutschen Medien wird das Bild vom bösen, dunkelhäutigen Drogendealer gepflegt, der schutzlose Kinder und Jugendliche zum Drogenkonsum verführt und im allgemeinen eine Gefahr für die zu verteidigende deutsche Leitkultur und ihre ach-so-anständigen Bürger darstellt.
An deutschen Drogenumschlagplätzen wie z.B. dem Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg sind es vor allem Flüchtlinge aus Nord- und Westafrika, die hier ihren kläglichen Lebensunterhalt mit dem Handel von kleinen Mengen Kokain, Heroin, Methamphetamin oder Cannabis verdienen. Man findet zwar auch den ein oder anderen deutschen Dealer, aber in den meisten Fällen sind es Asylsuchende aus Krisengebieten, denen sonst keine andere Möglichkeit bleibt, hier etwas Geld zu machen. Das deutsche Asylrecht verbietet es Flüchtlingen, in den ersten neuen Monaten nach ihrer Ankunft zu arbeiten. Auch danach dürfen sie einen Job nur annehmen, wenn sich kein deutscher oder europäischer Arbeitssuchender dafür finden lässt. Die Folge: Die meisten Asylsuchenden müssen sich mit Hartz-IV durchschlagen und werden dafür auch noch als Sozialschmarotzer beschimpft.
Viele der Kleindealer im Görlitzer Park haben aber noch nicht mal Hartz-IV. Sie haben nur ein Touristenvisum oder gar keine Papiere und sind über Spanien oder Italien illegal eingereist. Diesen Flüchtlingen droht die sofortige Abschiebung, würden sie in Deutschland Asyl beantragen. Deshalb sind bei den Razzien im Görlitzer Park und ähnlichen Drogenumschlagplätzen in der ganzen Bundesrepublik neben der Polizei auch immer Beamte der Einwanderungsbehörde – die diesen Namen kaum verdient hat – mit dabei. Denn ein illegaler Flüchtling, der auch noch mit Drogen handelt, kann ganz bequem, sofort und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls abgeschoben werden. Wie überaus praktisch.