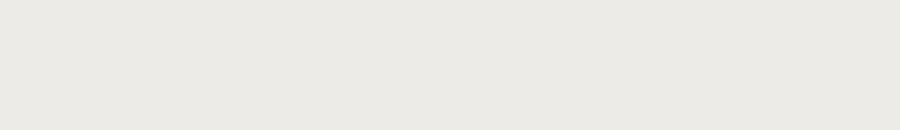Indien wäre nicht Indien, wenn alles nach Plan laufen würde. Vom Yoga-Städtchen Rishikesh, am Fuß des Himalajas gelegen, will ich ins Parvati-Tal reisen. Eine 500 Kilometer lange Strecke über kurvige, schmale Bergstraßen liegt vor mir, an deren Ende ich nach 16 Stunden Fahrt fast 1.500 Höhenmeter überwunden habe. Corona-bedingt gibt es keinen öffentlichen Fernverkehr, und so teile ich mir ein Taxi mit Freunden.
Ohrenbetäubende Musik plärrt aus den Lautsprechern des PKWs, zu denen der junge Fahrer mit großen Bewegungen und lauter, kratzender Stimme tanzt und singt. Sein glasiger, dauerbekiffter Blick richtet sich auf den Verkehr, aber seine Aufmerksamkeit ist ganz woanders. Auf der Rückbank suchen wir verzweifelt nach etwas Schlaf, doch zur lautstarken Musik weht eisiger Wind durch das weit geöffnete Fahrerfenster in den Innenraum, der uns die Möglichkeit eines Kältetods offenbart. Als wäre das nicht alles schlimm genug, sind meine beiden Begleiter aufgrund der halsbrecherischen Fahrweise auch noch dem Erbrechen nah.
Ein geplatzter Reifen bringt später eine ganz andere Misere mit sich. Es fehlen geeignete Werkzeuge für einen Reifenwechsel und der uralte Ersatzreifen im Kofferraum hat so wenig Profil wie ein Kaugummi. Kleinlaut versucht unser Fahrer in der Dunkelheit vorbeifahrende LKWs auf der verlassenen Bergstraße anzuhalten und um Hilfe beim Reifenwechsel zu bitten. Aber ohne Trinkgeld lässt sich in der bitterkalten Nacht natürlich niemand darauf ein. Viele frostige Stunden vergehen, aber irgendwann (viel später als geplant) stehe ich in den frühen Morgenstunden auf der Dachterrasse meiner Unterkunft. Mit einem heißen Chai in der Hand bewundere ich die mich umgebenden Berge. Hallo Parvati!

Um das Parvati Tal ranken sich zahlreiche Legenden. Sie erzählen von hinduistischen Göttern und ihren ach so menschlichen Charakterzügen – und sie erzählen von Haschisch. Besonders in den Coffeeshops Amsterdams, wo ein duftender Joint von einer Hand in die nächste wandert, gilt Parvati als Sehnsuchtsort.
Parvati, so heißt nicht nur der Fluss, der sich vor mir in frostiger Klarheit und umgeben von den mächtigen Gipfeln des Himalajas durch das gleichnamige Tal windet. Parvati, so heißt auch die hinduistische Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und Harmonie. Parvati ist mächtig, liebend, verspielt und sogar Shiva (Gott der Zerstörung und leidenschaftlicher Kiffer) ist ihr ergeben. Er verliebt sich in Parvati und meditiert den hinduistischen Erzählungen zufolge knapp 3000 Jahre hier in diesem Tal. Ich vermute ja, dass auch das betörende Cannabis einen Teil zur Meditation beitrug, das im Parvati-Tal überall an den Ufern der Flüsse und an den Berghängen wächst, wie bei uns Brennnesseln oder Disteln. Shiva, der seit jeher einen äußerst kurzen Geduldsfaden hat, schwört auf die Wirkung der Cannabispflanzen. Nur mit ihrem Genuss bekommt er seine Wutausbrüche in den Griff, nur mit ihrem Genuss gelingen ihm Meditation und Entspannung. Mangel an gutem Kraut braucht er im Parvati-Tal nicht zu fürchten. Es sei Shiva gegönnt. Als Gott der Zerstörung ist man ja auch ständig im Stress. Die Mythen, die man sich in Amsterdam über das Parvati-Tal erzählt, sind nicht minder faszinierend. Das Parvati-Tal, so heißt es dort, sei Indiens Kifferparadies und quasi die Wiege des Cannabis. Hier wächst es in überragender Qualität – unberührt von Menschenhand. Ungestüm wuchert es selbst zwischen den einfachen Häusern, die sich an steile Hänge schmiegen. Seit Tausenden von Jahren gehört Cannabis fest zur kulturellen Identität in den Bergen des Himalajas und besonders im Parvati-Tal, wo die Pflanze traditionell als wertvoller Rohstoff angesehen wird. Jedes Dorf hat hier seine eigenen Plantagen, denn die Fasern der Pflanze dienen als traditionelles Werkmaterial für Kleidung, Schuhe, Seile und Körbe. Die Blüten werden geraucht, die Samen gegessen.
Im indischen Himalaja ist Cannabis aber auch religiöses Heilmittel und Wirkstoff traditioneller Medizin. Cannabis ist so eng mit den Bräuchen und dem Leben der Region verwoben, dass selbst das indische Betäubungsmittelgesetz an seine Grenzen stößt. Zwar ist der Cannabiskonsum offiziell auch im Parvati-Tal verboten, doch die Autoritäten haben hier einfach keine Handlungsmöglichkeiten, wenn sie nicht den kompletten Alltag der hier lebenden Menschen kriminalisieren wollen. Und der Natur können sie die Pflanze ohnehin nicht verbieten.
Den sonnenverwöhnten Cannabisblüten, die hier seit jeher in stundenlanger Handarbeit zum weltbesten Haschisch (zu Charas) gerieben werden, eilt ein erstklassiger Ruf voraus. Seit den 80er Jahren strömen Touristen für einen aromatischen Cannabis-Rausch ins Parvati-Tal und erschließen den Bewohnern des Tals ein neues Einkommensfeld. Für die ansässigen Bauern wird Cannabis zum lukrativen Geschäft. Handgeriebenes Charas, geformt in cremig-weiche Kugeln, ist ihr oberstes Exportgut, das sich in Geschmack und in Farbgebung von Dorf zu Dorf unterscheidet.

Kasol und das große Geschäft
In den rund ein Dutzend Siedlungen im Parvati-Tal wird Charas fast überall verkauft. In den Cafés und Shops ist es unter der Hand erhältlich. Taxifahrer, Hotelbesitzer, ja sogar Chai Wallahs können Charas besorgen oder kennen zumindest jemand, der es kann. Besucher kommen von weit her, um hier einen besonderen Rausch zu erleben. Die Wenigsten kehren enttäuscht um.
Kasol ist das Herz und erster Anlaufpunkt im Parvati-Tal. Zwei sich kreuzende Straßen und eine Ansammlung schmuckloser Betonklötze bilden den größten Ort im Tal. Junge Männergruppen, meist reiche Hauptstädter aus dem 500 Kilometer entfernten Neu-Delhi, verbringen die Wochenenden hier. Sie wollen trinken, kiffen und feiern. Auch jetzt in Corona-Zeiten finden noch ab und zu kleinere Partys in den nahegelegenen Dörfern statt. Wer auf Abstand achtet, dröhnt sich im Hotelzimmer bei lauter Musik für zwei, drei Nächte zu, bevor es wieder nach Hause geht. Die Motivierteren unternehmen auch eine halbtägige Wanderung in eines der umliegenden Seitentäler, doch am beliebtesten ist ein Ausflug mit dem Auto nach Tosh (weit im Osten des Tals). Das Bergpanorama dort ist der perfekte Hintergrund für Selfies und der beliebte „Tosh Ball“ (das aromatische dorfeigene Charas) verspricht ein spitzenmäßiges High für einen geringen Betrag.
Doch der eigentliche Besucherzirkus bleibt im Hauptort Kasol. Auch ich miete mich hier in einem kleinen Gasthaus ein, dessen Besitzer mir bereits Charas anbietet, bevor ich überhaupt das Zimmer beziehe. Es ist ein vom Leben gezeichneter Kerl mittleren Alters, der mit dem Verkauf des handgeriebenen Haschischs zu Geld gekommen ist und dieses nun im Gastgewerbe reinvestiert, ohne etwas davon zu verstehen. Das ist ziemlich typisch für das Parvati-Tal. Seine sehr junge Frau bezeichnet sich selbst als Hotelmanagerin und ist so gelangweilt vom Dorfleben, dass sie sich jedem Gast penetrant als Trink- und Rauchbegleitung sowie als neue beste Freundin zur Verfügung stellt.
Die wenigen Anwohner in Kasol haben sich auf ihre wichtigste Klientel (feierwütige Oberschicht-Inder aus der Großstadt) eingestellt. Die üblicherweise herzlich-offene Art der Einheimischen, die mich nach einem dritten Besuch in ihrem Chai-Shop am Straßenstand schon als Mitglied der Familie ansehen, ist hier nur noch eine schöne Erinnerung. Stattdessen jagt in Kasol jeder dem eigenen Vorteil hinterher. Egal wo ich bin, wo ich esse oder trinke – immer und immer wieder wird versucht, mir mein Wechselgeld mindestens teilweise zu unterschlagen. Wer in Kasol ein Geschäft besitzt, wirkt in der Regel unterkühlt und unfreundlich. Die Sehnsucht nach den Heimatdörfern in den Bergen ist groß und Kasol nichts weiter als ein künstlich aufgeblähter Touristen-Spot. Alles hier ist auf Tourismus ausgelegt. Eine Handvoll Restaurants bietet Momos und Thukpa (tibetische Teig- und Nudelgerichte) zu überhöhten Preisen an. Was in den sieben „German Bakeries“ im Dorf verkauft wird, hat nichts mit deutschen Backwaren zu tun. Ihre Auslagen sind eher klebrig-süß: Nutella-Croissants, Apfel- und Schokokuchen, Käsekuchen, Chocolate Balls. Aber die Kundschaft ist selig, denn wer kennt nicht das süße Verlangen nach einem durchgekifften Morgen? Der westliche Gaumen wird hier gut versorgt: Frischer Apfelsaft aus der Region wird in recycelten Bierflaschen angeboten, der kleine Supermarkt im Ort verkauft Chips, Schokolade, Erdnussbutter und Donuts. Außerdem wird Kasol wohl für immer der einzige Ort in Indien bleiben, an dem ich keinen 10-Rupien-Chai finden kann.

Einige wenige Läden verkaufen dicke Jacken in bunten Farben und Rucksäcke aus Hanf. Doch die meisten Geschäfte in Kasol handeln mit Kiffer-Accessoires. Ihr Angebot reicht von Bongs über lange Blättchen, Filter, Tabak bis hin zu Chillums und dekorierten Feuerzeugen. Der einzige Geldautomat im Dorf hat an fünf Tagen in der Woche kein Geld. Ein mobiler Obstverkäufer mit hölzernem Karren verkauft billige Äpfel und teure Bananen. Weiter die Straße runter befindet sich eine lange Reihe einfacher Restaurants, jedes mit einer Ladenfläche von etwa vier Quadratmetern. Dort wird heißes Wasser auf Fertignudeln gegossen und mit einer gerösteten Viertelzwiebel verfeinert. Außerdem gibt es Chai, Schoko-Riegel und leere Joint-Hüllen zum Selbstfüllen.
Natürlich wird hier, so wie in jedem anderen Laden in Kasol, auch Charas verkauft. Die Nudeln sind nur Show. Das wissen alle, nur die einheimischen Touristen nicht, die mich ständig anquatschen, wo man hier etwas zu Rauchen kaufen könne. Ich bin immer wieder von Neuem überrascht. Ich habe noch nirgendwo in Kasol einen Fuß in ein Geschäft gesetzt, ohne dass mir innerhalb der ersten fünf Minuten Charas angeboten wurde. Charas, das ist doch der Grund, warum alle ins Parvati-Tal und nach Kasol kommen, oder?
Wie auch immer.
Ich schicke alle Fragenden zur kurzen, rostigen Brücke, die über den Fluss zum Nachbardorf Chalal führt. Sie ist das heimliche Herz Kasols. Hier sitzt man am Fluss und trifft sich. Hier entstehen pausenlos Selfies vor dem Hintergrund der hoch aufragenden Berge. Hier verkaufen zwölfjährige Jungs Charas. Hier betteln die Babas (die heiligen, kiffenden Männer Indiens) um Geld oder um einen Joint. Hier kann man auch
Kokain kaufen und all die zerstörten Gestalten finden, die Flyer für eine der jetzt selteneren Partys anbieten und in ihren Taschen alles Mögliche parat haben.
Die Dealer-Clique am Fluss
Hinter einem windschiefen Tisch, der aus irgendwelchen Holzresten zusammengezimmert wurde, steht ein junger Mann. Ausgerüstet mit einem Gaskocher und Zutaten in einem kleinen Pappkarton verkauft er Fertignudeln, Chai und Omelette. Manchmal steht sein kleiner Tisch verlassen da, weil er betrunken in der Nähe auf dem Boden eingeschlafen ist – dann kochen die Stammkunden ihren Chai einfach selbst und lassen (wenn sie auf ihr Karma bedacht sind) ein paar Münzen auf dem Tisch zurück.
Ich bin täglich an der Brücke und irgendwann wachsen mir die Typen, die Partyflyer und Drogen an die täglich wechselnde Laufkundschaft verteilen, ans Herz. Es sind abgehängte Gestalten, aber keine schlechten Menschen. Ihr Blick ist oft glasig, die Augen rot. Manchmal laufen sie mit großer Sonnenbrille und wackeligen Schritten verstrahlt an mir vorbei. Zwei Tage später (und frisch geduscht) machen sie dann aber einen ganz passablen Eindruck. Ich habe immer ein Lächeln für sie übrig, und manchmal auch einen kleinen Plausch beim Chai oder etwas Tabak (wenn sie danach fragen).
In der quirligen Hauptsaison voller Partys und den dazu passenden Drogen machen sie gute Geschäfte, gutes Geld. Sie sind dann immer dabei, immer drauf. Aber jetzt, wo die Touristen ausbleiben und die Partys verstummen, stehen sie etwas verloren in der Gegend rum. Die ständig wechselnden Bekanntschaften, mit denen sie üblicherweise gemeinsam in den nächtelangen, anonymisierten Rausch abtauchen, fehlen. Corona zerschlägt auch ihr Geschäftsmodell. Nun schleichen sie durch die Straßen einer Geister-Partystadt, immer auf der Suche nach den wenigen verbliebenen Kunden oder einem Plausch über alte Zeiten bei einem gemeinsamen Joint. Ihre Augen glänzen bei dem Gedanken an das, was einmal war. Ihre Geschichten klingen, als ob sie lange vergangen wären, dabei liegen sie erst wenige Monate zurück.
Manikaran und die heißen Quellen
Wenn Kasol die verruchte, zwielichtige Partyhochburg im Parvati-Tal ist (das schwarze Schaf sozusagen), dann ist die Siedlung Manikaran das blond gelockte Vorzeigekind. Vier Kilometer von Kasol entfernt ist dieser spirituelle Pilgerort das bevorzugte Reiseziel hinduistischer Gläubiger. Grund dafür sind die zahlreichen heißen Quellen, die sich am Rande des Parvati-Flusses befinden. In Manikaran brodelt und schäumt das Wasser, dampfender Rauch steigt auf und vermischt sich mit der kalten Bergluft. Geschwungene Tempel ragen zwischen niedrigen, bunt bemalten Häusern der lokalen Bevölkerung empor. Der imposante Manikaran-Tempel reicht über eine Brücke von einem Ufer zum anderen – in ihm
erzählen Priester die Legenden der heißen Quellen. In einer dieser uralten Geschichten verliert die Göttin Parvati einen Ohrring im rauschenden Fluss. Traurig klagt sie ihrem Mann Shiva den Verlust, der wiederum einen Helfer beauftragt, den Ohrring seiner geliebten Frau wiederzufinden. Nach langer, erfolgloser Suche kehrt dieser jedoch mit leeren Händen zurück. Shiva – immer ein wenig gereizt – ist nun rasend vor Wut. Sein Groll ist so dramatisch, dass das eiskalte Wasser des Flusses augenblicklich zu kochen beginnt und so Parvatis Ohrring an die Oberfläche sprudelt. Heute dampft das Wasser noch immer heiß in den Becken am Flussufer. Sadhus (die Wandermönche Indiens) sitzen halbnackt im warmen Nass und rauchen Chillums. Familien kehren zu religiösen Zeremonien, den Pujas, in die Tempel zurück. Auf den Straßen werden Samosas verkauft und über allem schrillt das indische Durcheinander
in einer Kakophonie aus Stimmen, Geschrei und Musik.
Das Beste vom Besten: Malana Cream
Das Parvati-Tal ist gespickt mit fantastischen Mythen, Shiva ist hier sehr präsent und mit ihm auch Cannabis. Die Verbindung von Gott und Kraut ist wesentlich, sie ist die Schnittstelle zwischen der spirituellen und materiellen Welt. Das winzige Dorf Malana gehört zwar zur materiellen Welt, ist aber nicht weniger Legende als Shiva und Parvati. Seine Bewohner sind berühmt dafür, mit ihren Händen das weltbeste Charas zu reiben: Malana Cream. Ölig schwarz von außen, urwaldgrün im Inneren, biegsam, aromatisch, potent und mit einem THC-Anteil von bis zu 40 %. In den Coffeeshops Amsterdams genießt Malana Cream den besten Ruf. Es ist die Crème de la Crème und zugleich eine der teuersten Haschischsorten überhaupt: ein Gramm kostet etwa 20 Euro. Doch im Parvati-Tal wird natürlich anders gerechnet. Hier wiegen Dealer ihr Charas in der historischen Maßeinheit Tola (=11,6 g) und verkaufen es für weniger als 11 Euro an die kiffende Meute.
Malana liegt an einem steilen Hang in einem Seitenarm des Parvati-Tals und ist nur zu Fuß zu erreichen. Schon der Aufstieg ins Dorf ist gesäumt von Cannabis. Ich laufe an kleinen und größeren Plantagen vorbei, aber auch an wilden Pflanzen, die am Wegrand wachsen. Dasselbe Bild bietet sich mir im Dorf. Auch hier wuchert es überall. Die Einwohner Malanas sind dagegen etwas eigen. Sie glauben, dass ihre Ahnen Teil des Heeres Alexanders des Großen waren, die sich, verwundet nach einer Schlacht mit dem indischen König Poros, hier im Tal niederließen. Aus dieser Abstammungslinie folgt ein Selbstbild, nach dem sich die Bewohner Malanas nicht als Inder, sondern als Arier sehen. Weil sie anders sind bzw. anders sein wollen, wünschen sie keinen Körperkontakt mit Menschen, die nicht aus ihrem Dorf stammen. In dieser Tradition bleiben selbst die flüchtigsten Berührungen mit Fremden untersagt. Ob das ein extravagantes Ego oder die überlebende Attitüde makedonischer Soldaten ist, sei dahingestellt.
Das Berührungsverbot jedenfalls macht den Besuch Malanas außergewöhnlich. Auf schmalen Bergpfaden begegnen mir die Dorfbewohner mit größtmöglichem Abstand und quetschen sich dabei mit dem Rücken betont eng an die Felswand. Auf freiem Feld laufen sie unnötig große Bögen um jeden, der nicht aus ihrer kleinen Gemeinschaft stammt. Diese Abstandsregeln sind geradezu vorbildlich, wenn man an die Corona-Pandemie denkt. Auch Läden und Geschäfte darf ich nicht betreten. Und jeden Artikel, den ich berühre, muss ich kaufen, wobei die Bezahlung und Übergabe der Waren stets über einen Umweg erfolgt. Was ich erwerbe, wird zuerst auf den Tisch oder Erdboden gelegt, von wo ich es schließlich aufheben darf. Etwas mit der Hand reichen zu wollen, erregt bizarres Entsetzen.
Ich stehe vor einem alten Haus mitten im Dorf. Feuerholz stapelt sich auf der knarrenden Veranda, bunte Wäsche trocknet an einer Leine, eine Satellitenschüssel gibt den Anschein von Moderne. Auf einer Terrasse im ersten Stock sitzt eine Frau im Schneidersitz in der Sonne. Ihre weite, bunte Kleidung und die wollene Strickjacke sind mit hellgrünen Blättern übersäht. Frisch geerntete Hanfpflanzen liegen um
sie herum. Zwischen ihren Händen hält sie bauchige Cannabisblüten.
Um das Haschisch aus der Pflanze zu gewinnen, reibt sie die Blüten für ein paar Sekunden leicht zwischen ihren Handballen hin und her. Die klebrigen Harze bleiben an den Handflächen haften, bevor sie
bereits zur nächsten Blüte greift. Im Parvati-Tal herrscht Überfluss – und das merke ich der Frau im Umgang mit der Pflanze an. Sie wirkt routiniert in ihrem Handwerk, verrichtet ihre Arbeit beiläufig, locker, leicht, lässig. Ein süßlicher Duft umgibt sie.

In Malana lebt die gesamte Dorfgemeinschaft vom Charas und jetzt (zur Erntesaison) ist jeder Haushalt mit der Haschischproduktion beschäftigt. Überall sehe ich Männer und Frauen jeden Alters, die die Blüten der Pflanzen massieren, bis daraus eine schwarze, ölige Masse hervortritt, die an ihren Händen kleben bleibt. Einige Frauen im Dorf produzieren ihr Charas am liebsten gehend, stehend oder mit den Nachbarinnen klönend. Dabei klemmen sie ein paar Pflanzen unter die Achsel und spazieren so durch die wenigen Gassen. Abgearbeitete Blüten lassen sie einfach fallen. Die erdigen Böden und Wege im Dorf sind folglich übersäht mit Pflanzenresten und Hanfsamen. Aus ihnen wachsen unbeachtete Pflanzen, die dann nicht einmal abgeerntet werden.
Vor einem der Wohnhäuser sitzt eine Großfamilie im Licht der Mittagssonne. Kleinkinder krabbeln und kreischen zwischen Hanfpflanzen umher. Die aufgeregte Atmosphäre wird untermalt von treibender Bollywood-Musik aus knackenden Lautsprecherboxen. Bereits den Kleinsten kleben dicke Klumpen Charas zwischen den Fingern. Dabei sind sie stolz wie Bolle es den Erwachsenen gleichzutun.
Die Bauern aus Malana leben in einfachen Verhältnissen. Sie konsumieren ihr Charas in der Regel nicht selbst und haben kein Verständnis dafür, dass sie hier eine (leichte) Droge herstellen bzw. eine Straftat begehen. Sie bewirtschaften ihre Plantagen, wie es bereits ihre Eltern und Großeltern taten. Tagein, tagaus. Jahr für Jahr.
Gesetze werden hier mit Bestechungsgeldern umgangen. Und wenn Polizisten gelegentlich Ortskontrollen durchführen, dann begnügen sie sich in der Regel mit kleinen Plantagen auf dem weiten Weg nach
Malana. Sie beschlagnahmen dann die Ernte und verkaufen diese anschließend selbst weiter. Für die Menschen in Malana ist das kein großer Verlust, denn die viel größeren, wirtschaftlich interessanten Plantagen befinden sich zwei Stunden Fußweg von Malana entfernt – im hochgepriesenen „Magic Valley“. Den anstrengenden Marsch dorthin unternehmen die Polizisten erst gar nicht.
Am späten Nachmittag kommen mir auf dem Weg zurück nach Kasol einige Männer und Frauen entgegen. Sie kehren aus dem Magic Valley zurück und tragen gewaltige, in große Decken und Tücher gewickelte Hanfballen auf ihren Rücken. Bereits auf dem steinigen Heimweg nach Malana reiben sie schon Charas zwischen den Händen. Blüte für Blüte fällt so auf den Boden, während die schwarzen, cremigen Klumpen in ihren Handflächen immer weiter anwachsen.

Zurück in Kasol merke ich den Wandel. Einige Wochen habe ich nun im Parvati-Tal verbracht und konnte dabei zusehen, wie feuchte Kälte in den Bergen die Überhand gewann, ich konnte fühlen, wie sie jeden Tag ein bisschen tiefer in die Knochen zieht. Dunst wabert an den Hängen und durch die Kiefernwälder.
Es ist Winter im Himalaja.
Kheerganga am Rand des Parvati-Tals
Die letzte meiner zahlreichen Wanderungen im Parvati-Tal bringt mich nach Kheerganga, auf fast 4000 Metern Höhe gelegen. Es ist der östlichste Ort im Tal, von Kasol aus eine vierstündige Wanderung durch dichten Kiefernwald. Die Wolken hängen tief und immer wieder zwingt mich leichter Nieselregen zu einer Chai-Pause am prasselnden Feuer kleiner, überdachter Teestände am Wegrand. Die Stimmung ist melancholisch und ich bewundere mit verträumtem Blick den dichten Nebel, wie er durch den Wald zieht und den Fluss weit unten im Tal in einen dichten Schleier hüllt.
Kheerganga ist eine Ansammlung gelber und grüner Plastikzelte und gleicht den Basislagern vieler Bergexpeditionen. Die Zelte sind mit feuchten Matratzen und dicken, schweren Wolldecken ausgestattet. Für einen kleinen Obolus können sie gemietet werden, versprechen aber schon beim ersten Betrachten keine gemütliche Nacht. Eingehüllt in eine dichte Wolkenwand macht die Zeltsiedlung bei meiner Ankunft einen düsteren Eindruck, auch der Nieselregen trägt seinen Teil dazu bei. Kheerganga wirkt tatsächlich wie das Ende des magischen Parvati-Tals, heute vielleicht sogar ein bisschen wie das Ende der Welt. Reis und Linsen gibt es zum langersehnten Abendessen, dann wird der Regen heftiger, prasselt gegen die schützenden Plastikplanen und versetzt mich gemeinsam mit dem Knistern des Feuers in einen behaglichen Dämmerzustand.
Der nächste Morgen zaubert mir ein breites Lächeln ins Gesicht. Der dichte Wolkenschleier hat sich aufgelöst und gibt den Blick auf die mächtigen, mich umgebenden Berge frei. Der erste Schnee in diesem Jahr liegt weit oben auf den Hängen. Unter einem strahlend blauen Himmel scheint an diesem Morgen alles perfekt zu sein: mein würziges indisches Kartoffelcurry, ein heißer Chai und mein letzter Tag im Parvati-Tal.